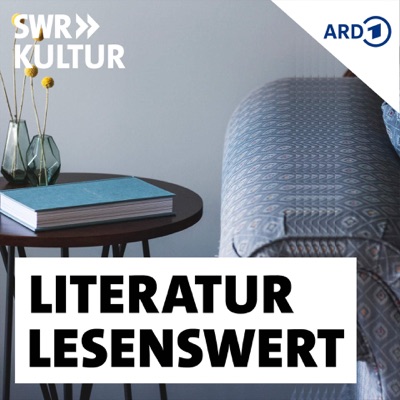Robert Macfarlane – Sind Flüsse Lebewesen? | Buchkritik
Update: 2025-08-28
Description
Flüsse in drei unterschiedlichen Klimazonen hat der britische Autor Robert Macfarlane für sein neues Buch „Sind Flüsse Lebewesen?“ besucht: in Südamerika, in Indien, in Nordamerika.
Anhand ihres Schicksals weist er auf die vielfältigen Schwierigkeiten hin, hin, die fließendes Wasser auf seinem Weg zur Küste zu bewältigen hat. Bedroht ist ihre jeweils besondere Schönheit, durch den Menschen, seine Industrie, seine Chemie, seine Landwirtschaft, seine ungehemmte Wassergier.
In Ecuador ist Macfarlane in das Quellgebiet des Río Los Cedros, in den Nebelwald aufgebrochen, um dessen wilde, ungezähmte Natur zu entdecken. Dank mutiger Richter ist es inzwischen unter strengen Naturschutz gestellt.
In Indien hat er sich in die Hafenstadt Chenai begeben, um dort die Misshandlung – anders kann man es wohl kaum nennen – dreier Flüsse zu dokumentieren. Sie dümpeln nur noch als Schatten ihrer selbst in den Golf von Bengalen, als schmutzige Rinnsale, ungenießbares Wasser, giftig für Mensch wie Natur, von korrupten Politikern an die Chemieindustrie verkauft.
Der dritte Fluss ist der Mutehekau Shipu in Kanada, bedroht durch Staudämme zur Stromgewinnung. Nach Ansicht des Autors „ertränken“ diese einen Fluss, denn das gestaute Wasser nimmt ihm seine Kraft, seine Lebendigkeit, seine Sedimente.
Die indigene Bevölkerung sieht den Fluss als eine heilige Gottheit an. Mit dem Segen einer Heilerin und der von ihr versprochenen Aussicht auf innere Erkenntnis, paddelt Robert Macfarlane mit ortskundigen Gefährten im Kajak flussabwärts. Ein Höllenritt, denn sie müssen sehr gefährliche Stromschnellen, reißende Strudel, enge Felsschluchten bewältigen.
Macfarlanes Vorgehensweise ist immer dieselbe. Er sucht sich engagierte Naturschützer vor Ort, die ihn führen, aufklären, unterstützen. Mit ihnen spürt er der Einzigartigkeit der Flüsse nach. Er beschreibt wortmalerisch ihr Wasser, das organische Leben in ihnen, die sie umgebende Natur. So erweckt er sie für uns Leser zum Leben – eine erstaunliche Leistung.
Immer wieder fügt er Zitate von Dichtern und Philosophen sowie wissenschaftliche Erkenntnisse in seinen Text ein.
Vor allem aber beschreibt er seine persönlichen Empfindungen und Gefühle angesichts des Zustands der Flüsse: Er macht aus seiner Wut, Verzweiflung, Begeisterung, Erschöpfung keinen Hehl. Das bringt uns Macfarlane nahe und macht ihn uns sympathisch.
Ihm gelingt es zudem, uns mit seiner Begeisterung anzustecken. Wir folgen ihm gerne, auch wenn seine Beschreibungen bisweilen arg lang geraten. Der erzählende Teil des Buches ist immerhin 341 Seiten lang. Es enthält aufschlussreiche Schwarz-Weiß-Fotos der Landschaften und Kartenausschnitte sowie am Ende ein umfangreiches Quellenverzeichnis.
Dabei verliert Macfarlane nie seine große Frage aus dem Auge, ob Flüsse als Lebewesen anzusehen sind. Dass seine Schilderungen sie lebendig machen, ihnen einen eigenen Charakter zusprechen, ist eine Antwort. Man versteht sie sofort.
Aber wichtiger ist die Frage, wer sie eigentlich vertritt, ihnen eine Stimme gibt, ihre Sprache versteht. “Was sagt uns der Fluss” formuliert es Robert Macfarlane, der sich als ihr Fürsprecher sieht, aber ihre Sprache eben auch nur interpretieren kann.
Jeder hört etwas anderes, je nachdem, ob er zu den indigenen Völkern gehört, die an den Flussufern wohnen, ein Umwelt- oder Naturschutzaktivist, ein Naturphilosoph, ein Wissenschaftler ist. Selbst wenn sie alle die Frage mit einem Ja beantworten, so sieht jeder im Fluss etwas anderes.
Und genau das ist die Crux mit der Antwort, so Macfarlane, denn jeder antwortet aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive. Der Fluss spricht, aber wir Menschen verstehen ihn nicht.
Anhand ihres Schicksals weist er auf die vielfältigen Schwierigkeiten hin, hin, die fließendes Wasser auf seinem Weg zur Küste zu bewältigen hat. Bedroht ist ihre jeweils besondere Schönheit, durch den Menschen, seine Industrie, seine Chemie, seine Landwirtschaft, seine ungehemmte Wassergier.
Drei Flüsse – drei Kontinente – drei Klimazonen
In Ecuador ist Macfarlane in das Quellgebiet des Río Los Cedros, in den Nebelwald aufgebrochen, um dessen wilde, ungezähmte Natur zu entdecken. Dank mutiger Richter ist es inzwischen unter strengen Naturschutz gestellt.
In Indien hat er sich in die Hafenstadt Chenai begeben, um dort die Misshandlung – anders kann man es wohl kaum nennen – dreier Flüsse zu dokumentieren. Sie dümpeln nur noch als Schatten ihrer selbst in den Golf von Bengalen, als schmutzige Rinnsale, ungenießbares Wasser, giftig für Mensch wie Natur, von korrupten Politikern an die Chemieindustrie verkauft.
Der dritte Fluss ist der Mutehekau Shipu in Kanada, bedroht durch Staudämme zur Stromgewinnung. Nach Ansicht des Autors „ertränken“ diese einen Fluss, denn das gestaute Wasser nimmt ihm seine Kraft, seine Lebendigkeit, seine Sedimente.
Die indigene Bevölkerung sieht den Fluss als eine heilige Gottheit an. Mit dem Segen einer Heilerin und der von ihr versprochenen Aussicht auf innere Erkenntnis, paddelt Robert Macfarlane mit ortskundigen Gefährten im Kajak flussabwärts. Ein Höllenritt, denn sie müssen sehr gefährliche Stromschnellen, reißende Strudel, enge Felsschluchten bewältigen.
Engagierte Naturschützer vor Ort
Macfarlanes Vorgehensweise ist immer dieselbe. Er sucht sich engagierte Naturschützer vor Ort, die ihn führen, aufklären, unterstützen. Mit ihnen spürt er der Einzigartigkeit der Flüsse nach. Er beschreibt wortmalerisch ihr Wasser, das organische Leben in ihnen, die sie umgebende Natur. So erweckt er sie für uns Leser zum Leben – eine erstaunliche Leistung.
Immer wieder fügt er Zitate von Dichtern und Philosophen sowie wissenschaftliche Erkenntnisse in seinen Text ein.
Vor allem aber beschreibt er seine persönlichen Empfindungen und Gefühle angesichts des Zustands der Flüsse: Er macht aus seiner Wut, Verzweiflung, Begeisterung, Erschöpfung keinen Hehl. Das bringt uns Macfarlane nahe und macht ihn uns sympathisch.
Ansteckende Begeisterung
Ihm gelingt es zudem, uns mit seiner Begeisterung anzustecken. Wir folgen ihm gerne, auch wenn seine Beschreibungen bisweilen arg lang geraten. Der erzählende Teil des Buches ist immerhin 341 Seiten lang. Es enthält aufschlussreiche Schwarz-Weiß-Fotos der Landschaften und Kartenausschnitte sowie am Ende ein umfangreiches Quellenverzeichnis.
Dabei verliert Macfarlane nie seine große Frage aus dem Auge, ob Flüsse als Lebewesen anzusehen sind. Dass seine Schilderungen sie lebendig machen, ihnen einen eigenen Charakter zusprechen, ist eine Antwort. Man versteht sie sofort.
Aber wichtiger ist die Frage, wer sie eigentlich vertritt, ihnen eine Stimme gibt, ihre Sprache versteht. “Was sagt uns der Fluss” formuliert es Robert Macfarlane, der sich als ihr Fürsprecher sieht, aber ihre Sprache eben auch nur interpretieren kann.
Jeder hört etwas anderes, je nachdem, ob er zu den indigenen Völkern gehört, die an den Flussufern wohnen, ein Umwelt- oder Naturschutzaktivist, ein Naturphilosoph, ein Wissenschaftler ist. Selbst wenn sie alle die Frage mit einem Ja beantworten, so sieht jeder im Fluss etwas anderes.
Und genau das ist die Crux mit der Antwort, so Macfarlane, denn jeder antwortet aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive. Der Fluss spricht, aber wir Menschen verstehen ihn nicht.
Comments
In Channel